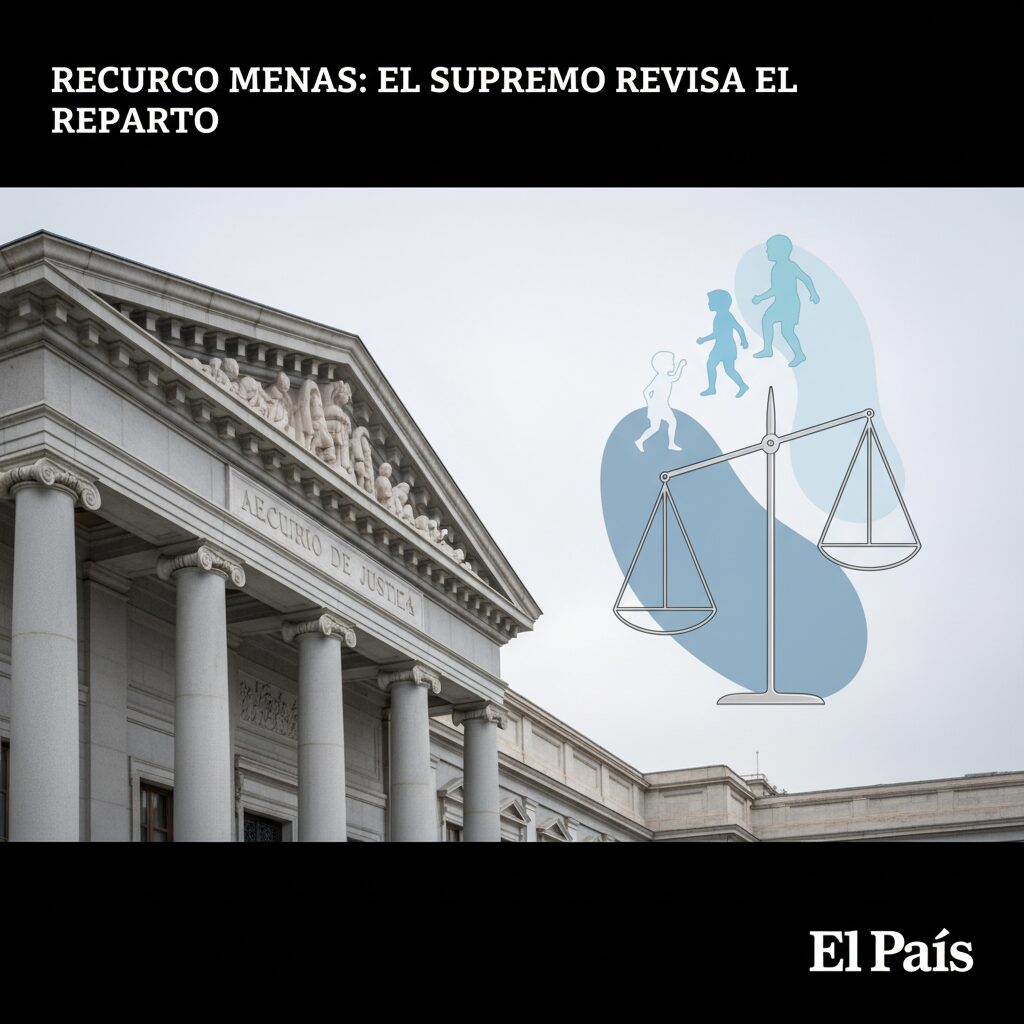Der spanische Oberste Gerichtshof hat das verwaltungsrechtliche Rechtsmittel der Autonomen Gemeinschaft der Balearen gegen das Dekret zur Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Migranten von den Kanarischen Inseln zugelassen. Der Sprecher der regionalen Regierung, Antoni Costa, verkündete dies am Freitag nach der Sitzung des Consell de Govern.
Das angefochtene Dekret 658/2025 zielt darauf ab, in außergewöhnlichen Migrationssituationen Maßnahmen zu ergreifen, um das Wohl von unbegleiteten minderjährigen Migranten zu schützen. Dies ist bereits der zweite juristische Schritt der Regierung unter Marga Prohens. Zuvor hatte sie im März zusammen mit anderen von der PP geführten Regionen und Kastilien-La Mancha, die von der PSOE regiert wird, den Verfassungsgerichtshof gegen eine Änderung des Ausländergesetzes angerufen.
Balearen gehen gegen geplanten Menas-Rechtsakt vor
Die balearische Regierung argumentiert, dass das Dekret die verfassungsmäßigen Prinzipien der Autonomie und Solidarität zwischen den autonomen Gemeinschaften verletzt und keine Willkürfreiheit der öffentlichen Gewalt bei der Verteilung der Minderjährigen gewährleistet. Zudem könnte es die finanzielle Autonomie der Balearen erheblich beeinträchtigen, da es das Schutzsystem für Minderjährige gefährdet und die Verwaltung der dafür bestimmten Mittel erschwert.
Das Ziel der Rechtsmittel sei es, dass das Oberste Gericht vorläufig die Aufnahme der 49 erwarteten menas in den Balearen stoppt, nicht aber deren Verteilung in andere Regionen Spaniens. Sobald die Verteilung aktiviert wird und die Anzahl der Minderjährigen für jede Region feststeht, müsste die spanische Regierung ein spezifisches Rechtsinstrument nur für die Balearen erlassen.
Laut der spanischen Zentralregierung beläuft sich die Aufnahmekapazität für unbegleitete minderjährige Migranten auf 32,6 Plätze pro 100.000 Einwohner, was 406 für die Balearen bedeutet. Derzeit werden dort jedoch bereits 682 minderjährige Migranten betreut, was zu einer Überbelegung von 1.150% führt. Trotz eines Rekordbudgets von 28 Millionen Euro für 2025 verlangt die Situation zusätzliche Lösungen.